zurück zur Übersicht
20.03.2025 - "Manche Kinder sind in Heimgruppen besser aufgehoben als in Pflegefamilien"
Einige Kinder brauchen mehr als eine Familie. Im Salberghaus finden sie in kleinen Gruppen professionelle Betreuung und stabile Beziehungen. Stephan Dauer, langjähriger Gesamtleiter, blickt im Gespräch mit Christina Beischl zurück auf die Herausforderungen und Chancen der stationären Unterbringung.

Stephan Dauer, von 2014 bis 2020 Gesamtleiter der KJF-Einrichtung Salberghaus. Fotos: Gabriele Heigl/KJF
Wann haben Sie im Salberghaus begonnen?
Stephan Dauer: Ich bin im November 1991 gekommen und habe im Juli 2020 aufgehört.
In welcher Funktion haben Sie angefangen?
Ich wurde als Erziehungsleiter im stationären Bereich eingestellt und war für fünf Wohngruppen mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren zuständig, darunter auch Säuglinge ab der zweiten Lebenswoche. Zu Beginn gab es zehn Wohngruppen. Es war eine reine stationäre Einrichtung.
Wie entwickelte sich Ihre Rolle weiter?
Nach etwa zehn Jahren übernahm ich die pädagogische Leitung für das gesamte Haus. Ich habe mich um die inhaltliche Arbeit gekümmert, während der - neue - Gesamtleiter vor allem die Außenkontakte pflegte. Gemeinsam entschieden wir, dass es sinnvoll wäre, das Salberghaus breiter aufzustellen und nicht nur stationär zu arbeiten. Wir richteten eine zusätzliche Vorschul-HPT-Gruppe ein und entwickelten dann die erste Kinderkrippe in München unter unserer Trägerschaft. Der Bedarf an Krippenplätzen wurde in der Stadt immer größer, und wir bauten über die Jahre vier weitere Kindertagesstätten im ambulanten Bereich auf. Zwei dieser Einrichtungen betreuten wir in Zusammenarbeit mit der Stadt München, darunter auch eine Einrichtung in der Messestadt Riem. Es war ein ständiger, teils mühsamer Prozess, da wir für jede neue Einrichtung Genehmigungen und Betriebserlaubnisse einholen mussten und immer auf der Suche nach qualifiziertem pädagogischen Personal waren.
Stephan Dauer: Ich bin im November 1991 gekommen und habe im Juli 2020 aufgehört.
In welcher Funktion haben Sie angefangen?
Ich wurde als Erziehungsleiter im stationären Bereich eingestellt und war für fünf Wohngruppen mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren zuständig, darunter auch Säuglinge ab der zweiten Lebenswoche. Zu Beginn gab es zehn Wohngruppen. Es war eine reine stationäre Einrichtung.
Wie entwickelte sich Ihre Rolle weiter?
Nach etwa zehn Jahren übernahm ich die pädagogische Leitung für das gesamte Haus. Ich habe mich um die inhaltliche Arbeit gekümmert, während der - neue - Gesamtleiter vor allem die Außenkontakte pflegte. Gemeinsam entschieden wir, dass es sinnvoll wäre, das Salberghaus breiter aufzustellen und nicht nur stationär zu arbeiten. Wir richteten eine zusätzliche Vorschul-HPT-Gruppe ein und entwickelten dann die erste Kinderkrippe in München unter unserer Trägerschaft. Der Bedarf an Krippenplätzen wurde in der Stadt immer größer, und wir bauten über die Jahre vier weitere Kindertagesstätten im ambulanten Bereich auf. Zwei dieser Einrichtungen betreuten wir in Zusammenarbeit mit der Stadt München, darunter auch eine Einrichtung in der Messestadt Riem. Es war ein ständiger, teils mühsamer Prozess, da wir für jede neue Einrichtung Genehmigungen und Betriebserlaubnisse einholen mussten und immer auf der Suche nach qualifiziertem pädagogischen Personal waren.

Stephan Dauer bei seinem Abschied mit den 29 Kalenderbüchern, die er in seinen 29 Jahren beim Salberghaus vollgeschrieben hat.
Aber dann wurden Sie Gesamtleiter.
Ja, im Jahr 2014. Ich konzentrierte mich vor allem darauf, den Betrieb zu stabilisieren, Mitarbeitende zu rekrutieren und die Einrichtung als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Das Salberghaus wurde 2008 als erste Einrichtung der KJF mit dem "Great Place to Work"-Zertifikat ausgezeichnet. Solche Auszeichnungen halfen uns, das Haus nach außen als mitarbeiterfreundlich zu platzieren. Ein besonderes Anliegen war mir dabei die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Wir entwickelten ein Fortbildungsprogramm, das für neue Kolleginnen und Kollegen in Teilen verpflichtend war und Weiterentwicklungsmaßnahmen für erfahrene Kräfte anbot. Damit gelang es uns, die Einrichtung inhaltlich weiterzubringen und das Fachwissen der Mitarbeitenden ständig zu vertiefen.
Ja, im Jahr 2014. Ich konzentrierte mich vor allem darauf, den Betrieb zu stabilisieren, Mitarbeitende zu rekrutieren und die Einrichtung als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Das Salberghaus wurde 2008 als erste Einrichtung der KJF mit dem "Great Place to Work"-Zertifikat ausgezeichnet. Solche Auszeichnungen halfen uns, das Haus nach außen als mitarbeiterfreundlich zu platzieren. Ein besonderes Anliegen war mir dabei die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Wir entwickelten ein Fortbildungsprogramm, das für neue Kolleginnen und Kollegen in Teilen verpflichtend war und Weiterentwicklungsmaßnahmen für erfahrene Kräfte anbot. Damit gelang es uns, die Einrichtung inhaltlich weiterzubringen und das Fachwissen der Mitarbeitenden ständig zu vertiefen.
Gab es in Ihrer Zeit wichtige inhaltliche Entwicklungen?
Die gab es, insbesondere in Bezug auf die stationäre Unterbringung von Kleinkindern. Die Fremdplatzierung von kleinen Kindern in einer Jugendhilfeeinrichtung war seit den 1970er-Jahren sehr umstritten. Es gab große Debatten über das Säuglingsheimsterben in den 1960er-Jahren und die Auswirkungen von Hospitalismus. Wir mussten deshalb mit spezifischen inhaltlichen Maßnahmen nachweisen, dass manche Kinder in kleinen Heimgruppen besser aufgehoben sind als in Pflegefamilien. Das betrifft vor allem Kinder mit schweren Bindungsstörungen, die in chaotischen Verhältnissen aufgewachsen sind. Solche Kinder könnten in Pflegefamilien ihre traumatischen Erfahrungen re-inszenieren, was oft dazu führt, dass die Familien überfordert sind und das Kind erneut aus der Familie genommen werden muss. Ein weiteres traumatisches Erlebnis, das es zu vermeiden gilt.
Was ist Ihrer Meinung nach die beste Betreuungsform - Heim oder Pflegefamilie?
Das muss man auch vor dem Hintergrund der Bindungstheorie einordnen. Bindungstheoretisch gesehen ist es für kleine Kinder ein großer Unterschied, ob sie in einer Pflegefamilie maximal zwei Bezugspersonen haben, oder wie im Schichtdienst sechs bis sieben. Allerdings gibt es Kinder, die stark beziehungsunsicher oder beziehungsgestört sind. Diese Kinder reagieren oft aggressiv oder ablehnend und lassen Nähe kaum zu. Für solche Fälle kann die stationäre Betreuung in kleinen Gruppen im Heim die stabilere Lösung sein, da sie dort rund um die Uhr von geschultem Personal betreut werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Erzieherinnen nach ihrem Dienst in eine gewisse Distanz gehen können und mit einer objektiveren Haltung zum Kind zurückkehren.
Welche drei Worte beschreiben Ihre Zeit im Salberghaus?
Intensiv, anstrengend, sinnstiftend.
Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den Eltern verändert?
Als ich ins Salberghaus kam, gab es einmal pro Woche einen Besuchsnachmittag, bei dem alle Eltern gemeinsam in einem großen Raum waren. Das war sehr laut, und es war schwierig, eine individuelle Beziehung zu gestalten. Über die Jahre haben wir die Elternarbeit differenziert, was gerade für Kinder aus Missbrauchsmilieus wichtig ist. Es gab eng begleitete Besuchskontakte, bei denen wir die Eltern kennenlernen und beobachten konnten, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Für uns war entscheidend, in den ersten sechs Monaten die Eltern-Kind-Beziehung zu fördern und die Chancen einer möglichen Rückführung zu evaluieren. Wenn ein Kind länger als anderthalb Jahre bei uns blieb, ging die Wahrscheinlichkeit einer Rückführung jedoch gegen null.
Die gab es, insbesondere in Bezug auf die stationäre Unterbringung von Kleinkindern. Die Fremdplatzierung von kleinen Kindern in einer Jugendhilfeeinrichtung war seit den 1970er-Jahren sehr umstritten. Es gab große Debatten über das Säuglingsheimsterben in den 1960er-Jahren und die Auswirkungen von Hospitalismus. Wir mussten deshalb mit spezifischen inhaltlichen Maßnahmen nachweisen, dass manche Kinder in kleinen Heimgruppen besser aufgehoben sind als in Pflegefamilien. Das betrifft vor allem Kinder mit schweren Bindungsstörungen, die in chaotischen Verhältnissen aufgewachsen sind. Solche Kinder könnten in Pflegefamilien ihre traumatischen Erfahrungen re-inszenieren, was oft dazu führt, dass die Familien überfordert sind und das Kind erneut aus der Familie genommen werden muss. Ein weiteres traumatisches Erlebnis, das es zu vermeiden gilt.
Was ist Ihrer Meinung nach die beste Betreuungsform - Heim oder Pflegefamilie?
Das muss man auch vor dem Hintergrund der Bindungstheorie einordnen. Bindungstheoretisch gesehen ist es für kleine Kinder ein großer Unterschied, ob sie in einer Pflegefamilie maximal zwei Bezugspersonen haben, oder wie im Schichtdienst sechs bis sieben. Allerdings gibt es Kinder, die stark beziehungsunsicher oder beziehungsgestört sind. Diese Kinder reagieren oft aggressiv oder ablehnend und lassen Nähe kaum zu. Für solche Fälle kann die stationäre Betreuung in kleinen Gruppen im Heim die stabilere Lösung sein, da sie dort rund um die Uhr von geschultem Personal betreut werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Erzieherinnen nach ihrem Dienst in eine gewisse Distanz gehen können und mit einer objektiveren Haltung zum Kind zurückkehren.
Welche drei Worte beschreiben Ihre Zeit im Salberghaus?
Intensiv, anstrengend, sinnstiftend.
Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den Eltern verändert?
Als ich ins Salberghaus kam, gab es einmal pro Woche einen Besuchsnachmittag, bei dem alle Eltern gemeinsam in einem großen Raum waren. Das war sehr laut, und es war schwierig, eine individuelle Beziehung zu gestalten. Über die Jahre haben wir die Elternarbeit differenziert, was gerade für Kinder aus Missbrauchsmilieus wichtig ist. Es gab eng begleitete Besuchskontakte, bei denen wir die Eltern kennenlernen und beobachten konnten, wie sie mit ihren Kindern umgehen. Für uns war entscheidend, in den ersten sechs Monaten die Eltern-Kind-Beziehung zu fördern und die Chancen einer möglichen Rückführung zu evaluieren. Wenn ein Kind länger als anderthalb Jahre bei uns blieb, ging die Wahrscheinlichkeit einer Rückführung jedoch gegen null.

Agnes Gschwendtner, die aktuelle Gesamtleiterin des Salberghaus. Foto: privat
Wie sind Sie mit skeptischen Eltern umgegangen?
Erstaunlicherweise ist es uns oft gelungen, auch mit Eltern Vertrauen aufzubauen, die uns anfangs misstrauisch gegenüberstanden. Die Eltern sahen nach und nach, dass es ihren Kindern bei uns gut ging, und dass wir sie nicht stigmatisierten, sondern darauf bedacht waren, die Entwicklung des Kindes zu fördern und ihnen als Eltern weiterhin Raum zu geben.
Am Ende Ihrer Salberghauszeit mussten Sie sich der Herausforderung Corona stellen.
Das war besonders schwierig. Wir mussten Kontaktbeschränkungen einführen, um die Kinder und Mitarbeitenden zu schützen. Kinder, die unsicher in Bindungen sind, hinterfragen Regeln stärker, und durch das Ausbleiben der Elternbesuche wurde das Gruppenregelwerk für die Kinder präsenter. Gleichzeitig entstanden auch mehr Sicherheiten im Alltag. Doch natürlich zeigten die Kinder auch Trauer, da sie nicht verstehen konnten, warum ihre Eltern nicht mehr kamen.
Erstaunlicherweise ist es uns oft gelungen, auch mit Eltern Vertrauen aufzubauen, die uns anfangs misstrauisch gegenüberstanden. Die Eltern sahen nach und nach, dass es ihren Kindern bei uns gut ging, und dass wir sie nicht stigmatisierten, sondern darauf bedacht waren, die Entwicklung des Kindes zu fördern und ihnen als Eltern weiterhin Raum zu geben.
Am Ende Ihrer Salberghauszeit mussten Sie sich der Herausforderung Corona stellen.
Das war besonders schwierig. Wir mussten Kontaktbeschränkungen einführen, um die Kinder und Mitarbeitenden zu schützen. Kinder, die unsicher in Bindungen sind, hinterfragen Regeln stärker, und durch das Ausbleiben der Elternbesuche wurde das Gruppenregelwerk für die Kinder präsenter. Gleichzeitig entstanden auch mehr Sicherheiten im Alltag. Doch natürlich zeigten die Kinder auch Trauer, da sie nicht verstehen konnten, warum ihre Eltern nicht mehr kamen.
Wie haben Sie die Arbeit mit den Kindern strukturiert?
Durch unser Fortbildungsprogramm haben wir die Erziehungskompetenz der Mitarbeitenden gezielt erweitert, da die Arbeit mit bindungsgestörten Kindern besondere Anforderungen stellt. Wir haben individuelle Erziehungspläne entwickelt, die alle Mitarbeitenden im Schichtdienst einheitlich umsetzen mussten. Kinder versuchen oft, die Erwachsenen gegeneinander auszuspielen, und daher war eine einheitliche Vorgehensweise wichtig, um den Kindern Stabilität zu bieten. Als pädagogischer Leiter habe ich viele interne Fortbildungen gegeben und Mitarbeitende in Krisensituationen begleitet. Dabei ging es auch manchmal um die Frage, ob ein Kind weiterhin in der Gruppe bleiben kann, oder ob es eine andere Unterbringungsmöglichkeit braucht. Gemeinsam haben wir überlegt, wie wir das Beste für das Kind erreichen können, ohne die Sicherheit der anderen Kinder in der Gruppe zu gefährden.
Was, wenn ein Kind dennoch nicht mehr in der Gruppe gehalten werden konnte?
Das waren Extremfälle. Das Salberghaus ist nach wie vor dafür bekannt, auch schwierigste Fälle in der Gruppe halten zu können. Das verlangt von den Mitarbeitenden jedoch extrem viel Hingabe und Ressourcen. In unseren Fortbildungen haben wir stets darauf hingewiesen, dass Mitarbeitende das ablehnende Verhalten eines Kindes nicht persönlich nehmen dürfen. Ein großer Vorteil des Schichtdienstes gegenüber einer Pflegefamilie ist, dass die Mitarbeitenden nach ihrem Dienst Distanz gewinnen können. Auch wenn ein Kind vielleicht aggressiv auf sie reagiert hat - etwa durch Schlagen oder Spucken - können sie nach einer Pause mit einer neuen, objektiveren Haltung zurückkehren, ohne beim Kind Täterprofile zu entwickeln. In meinen Fachartikeln habe ich immer wieder betont, wie wichtig für bindungsgestörte Kinder der Kontext von mehreren zuverlässigen Bezugspersonen ist, im Gegensatz zu einer Pflegefamilie. Dies ist entscheidend. Für solche Kinder müssen die Mitarbeitenden kontinuierlich geschult werden.
Durch unser Fortbildungsprogramm haben wir die Erziehungskompetenz der Mitarbeitenden gezielt erweitert, da die Arbeit mit bindungsgestörten Kindern besondere Anforderungen stellt. Wir haben individuelle Erziehungspläne entwickelt, die alle Mitarbeitenden im Schichtdienst einheitlich umsetzen mussten. Kinder versuchen oft, die Erwachsenen gegeneinander auszuspielen, und daher war eine einheitliche Vorgehensweise wichtig, um den Kindern Stabilität zu bieten. Als pädagogischer Leiter habe ich viele interne Fortbildungen gegeben und Mitarbeitende in Krisensituationen begleitet. Dabei ging es auch manchmal um die Frage, ob ein Kind weiterhin in der Gruppe bleiben kann, oder ob es eine andere Unterbringungsmöglichkeit braucht. Gemeinsam haben wir überlegt, wie wir das Beste für das Kind erreichen können, ohne die Sicherheit der anderen Kinder in der Gruppe zu gefährden.
Was, wenn ein Kind dennoch nicht mehr in der Gruppe gehalten werden konnte?
Das waren Extremfälle. Das Salberghaus ist nach wie vor dafür bekannt, auch schwierigste Fälle in der Gruppe halten zu können. Das verlangt von den Mitarbeitenden jedoch extrem viel Hingabe und Ressourcen. In unseren Fortbildungen haben wir stets darauf hingewiesen, dass Mitarbeitende das ablehnende Verhalten eines Kindes nicht persönlich nehmen dürfen. Ein großer Vorteil des Schichtdienstes gegenüber einer Pflegefamilie ist, dass die Mitarbeitenden nach ihrem Dienst Distanz gewinnen können. Auch wenn ein Kind vielleicht aggressiv auf sie reagiert hat - etwa durch Schlagen oder Spucken - können sie nach einer Pause mit einer neuen, objektiveren Haltung zurückkehren, ohne beim Kind Täterprofile zu entwickeln. In meinen Fachartikeln habe ich immer wieder betont, wie wichtig für bindungsgestörte Kinder der Kontext von mehreren zuverlässigen Bezugspersonen ist, im Gegensatz zu einer Pflegefamilie. Dies ist entscheidend. Für solche Kinder müssen die Mitarbeitenden kontinuierlich geschult werden.
"Das Salberghaus ist nach wie vor dafür bekannt, auch schwierigste Fälle in der Gruppe halten zu können. Das verlangt von den Mitarbeitenden jedoch extrem viel Hingabe und Ressourcen."
Stephan Dauer, ehemaliger Gesamtleiter SalberghausGab es Momente, die Sie besonders erfüllt haben?
Es war immer sehr erfüllend, wenn man sah, wie sich Kinder, die hoch traumatisiert zu uns kamen, gut entwickelten und entweder erfolgreich zurückgeführt oder in eine Langzeit-Pflegefamilie vermittelt werden konnten. Besonders schön war es auch, wenn sich ehemalige Kinder als Erwachsene an uns wandten, um mehr über ihre Biografie und ihre Herkunft zu erfahren. Ich fand diese Gespräche immer sehr spannend und habe es als bereichernd empfunden, wenn wir den Menschen helfen konnten, die Gründe für ihre Lebenswege besser zu verstehen.
Wie sind Sie mit schwierigen Situationen umgegangen?
Es gab sehr viele schwierige Situationen. Besonders im Kontext von eskalierenden Elternkontakten war es wichtig, dass die Mitarbeitenden wussten, dass ich hinter ihnen stehe. Auch bei schwierigen Situationen unter den Kindern, etwa bei aggressivem oder sexualisiertem Verhalten, wurden klare Handlungspläne erstellt, um ein sicheres Umfeld zu schaffen und die Mitarbeitenden durch solche Krisen zu begleiten.
Es sieht so aus, als ob Ihr Herz immer noch am Salberghaus hängt.
Ja, ich habe für mein Leben gerne die Teambesprechungen und Beratungsgespräche mit den Teams geleitet. Das ist auch der Grund, warum ich nun darüber nachdenke, eventuell ehrenamtlich als Supervisor tätig zu werden.
Ein Herzensanliegen zum Schluss?
Mich erschüttert, wie sich die Erziehungsvorstellungen im Elementarbereich aktuell verändern. Ich beobachte oft Kinder, die ihre Eltern tyrannisieren, weil diese ihnen keine verlässliche Beziehungsstruktur mehr bieten und die Kinder zu früh in eine diffuse Selbstbestimmung geraten. Ich fürchte, dass die langfristigen Auswirkungen dieser Erziehungsmuster sich negativ auf die Belastbarkeit dieser Kinder auswirken könnten.
Es war immer sehr erfüllend, wenn man sah, wie sich Kinder, die hoch traumatisiert zu uns kamen, gut entwickelten und entweder erfolgreich zurückgeführt oder in eine Langzeit-Pflegefamilie vermittelt werden konnten. Besonders schön war es auch, wenn sich ehemalige Kinder als Erwachsene an uns wandten, um mehr über ihre Biografie und ihre Herkunft zu erfahren. Ich fand diese Gespräche immer sehr spannend und habe es als bereichernd empfunden, wenn wir den Menschen helfen konnten, die Gründe für ihre Lebenswege besser zu verstehen.
Wie sind Sie mit schwierigen Situationen umgegangen?
Es gab sehr viele schwierige Situationen. Besonders im Kontext von eskalierenden Elternkontakten war es wichtig, dass die Mitarbeitenden wussten, dass ich hinter ihnen stehe. Auch bei schwierigen Situationen unter den Kindern, etwa bei aggressivem oder sexualisiertem Verhalten, wurden klare Handlungspläne erstellt, um ein sicheres Umfeld zu schaffen und die Mitarbeitenden durch solche Krisen zu begleiten.
Es sieht so aus, als ob Ihr Herz immer noch am Salberghaus hängt.
Ja, ich habe für mein Leben gerne die Teambesprechungen und Beratungsgespräche mit den Teams geleitet. Das ist auch der Grund, warum ich nun darüber nachdenke, eventuell ehrenamtlich als Supervisor tätig zu werden.
Ein Herzensanliegen zum Schluss?
Mich erschüttert, wie sich die Erziehungsvorstellungen im Elementarbereich aktuell verändern. Ich beobachte oft Kinder, die ihre Eltern tyrannisieren, weil diese ihnen keine verlässliche Beziehungsstruktur mehr bieten und die Kinder zu früh in eine diffuse Selbstbestimmung geraten. Ich fürchte, dass die langfristigen Auswirkungen dieser Erziehungsmuster sich negativ auf die Belastbarkeit dieser Kinder auswirken könnten.
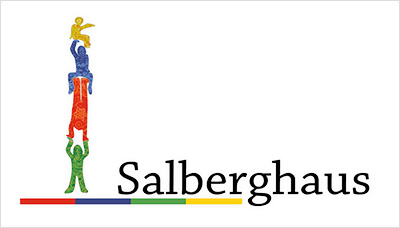
Unsere Einrichtung: Salberghaus Das Salberghaus ist eine fachlich anerkannte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mit vielfältigen stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten im Schwerpunkt für Kinder im Alter von null bis sieben Jahren. Neben der Betreuung und Förderung der Kinder stellt die Beratung, Begleitung und Unterstützung von Eltern und Familien einen wichtigen Bestandteil der Arbeit dar. Das Angebot umfasst Therapeutische Wohngruppen, eine Notaufnahme, Fachdienste, eine Heilpädagogische Tagesstätte, Kindertageseinrichtungen und eine Pädagogische Familienhilfe. Engagierte Fachkräfte wie ErzieherInnen, TherapeutInnen, SozialpädagogInnen und PsychologInnen bieten etwa 330 Kindern Geborgenheit, ein stabiles Beziehungsangebot und einen guten Platz zum Großwerden. Darüber hinaus werden etwa 160 weitere Familien jährlich in Form von ambulanter Erziehungshilfe und Frühen Hilfen unterstützt.




